Buchtipps
Eins
Winfried Thiessen* | Sommerferien, endlich. Ich sitze bei angenehmen Temperaturen auf einer Terrasse im Weserbergland mit Blick ins Tal, muss mich um nichts kümmern, wohne All Inclusive bei den Schwiegereltern. Mein Leben besteht im Wesentlichen aus den zahlreichen Mahlzeiten, also aus Kauen, Schlucken und kleinen Verdauungsspaziergängen. Hin und wieder werfe ich auch ein paar Boulekugeln, aber ansonsten habe ich mehr als genug Zeit zum Lesen. Eingepackt habe ich mir Die Seelen von London von A.K.Benedict, einer engelsgleichen, jung und unschuldig aussehenden Autorin. Ich war gespannt. Bei Die Seelen von London handelt es sich um einen Genremix, einer Mischung aus Krimi, Thriller und Fantasyroman mit kleinen Horroreinsprengseln, die, soviel schon mal vorweg, für meinen Geschmack oft unfreiwillig komisch gerieten.
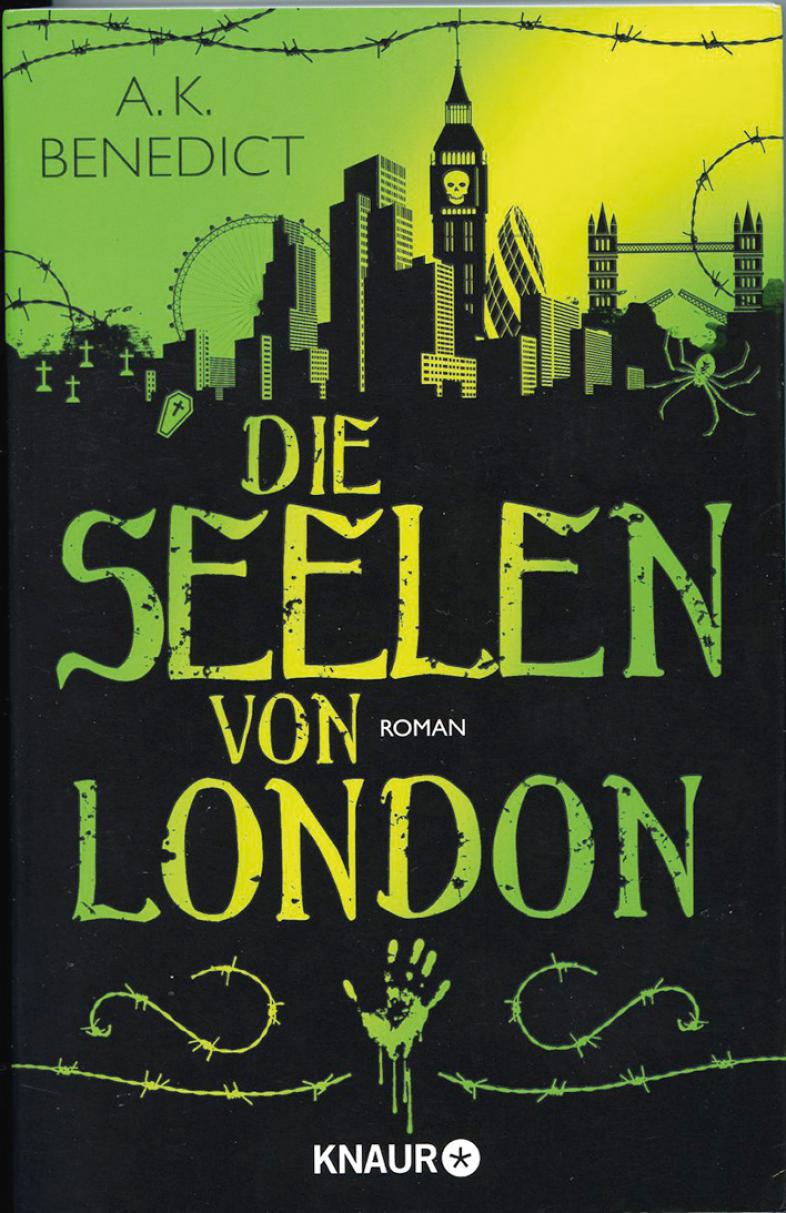
Und darum geht es: Eine blinde junge Frau, Anfang 30, findet im Schlamm des Themse-Ufers in London einen Ring nebst dazu gehörigem Finger. Was hat diese blinde junge Frau auch am Themse-Ufer im Dreck herumzuwühlen? Die Antwort: Maria, so heißt unsere blinde Protagonistin, ist eine Art Schatzsucherin aus Passion und arbeitet für ein Museum. Sie durchwühlt regelmäßig den Schlick auf der Suche nach seltenen historischen Artefakten.
Und das alles und noch viel mehr über sie weiß auch ihr Stalker, der den Ring so am Ufer platziert hat, dass sie ihn finden musste. Ring und Finger sind eine Liebesbotschaft, ein Heiratsantrag an Maria. Jetzt sollte man vielleicht noch wissen, dass die vorherige Auserwählte die Avancen des Stalkers nicht wirklich überlebt, sprich ein gewaltsames Ende gefunden hatte.
Detective Inspector Jonathan Dark sieht schnell eine Verbindung zwischen Maria und dem ersten Opfer des Stalkers, dessen Tod er damals nicht verhindern und aufklären konnte – ein Umstand, der immer noch an ihm nagt. Erschwerend für seine Ermittlungen kommt hinzu, dass er gerade nicht so ganz bei der Sache ist. Seine Frau hat ihn betrogen und aus dem Haus geworfen, sein Nachfolger ist bereits eingezogen, und Dark wird selber zum Stalker, streunt um sein Eigenheim herum und beobachtet den neuen Bewohner. Außerdem will seine Gattin die Scheidung und droht mit Jonathan Darks Faible für das Tragen von Frauenkleidern an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, und dann verguckt er sich auch noch in Maria, die vielleicht mehr Verständnis für seinen Spleen aufbringen könnte. Soweit so gut. Erschwerend kommt nun noch hinzu, dass in London eine Geheimgesellschaft aus höheren Kreisen, die sich selbst Der Ring nennt, zum Zwecke der schnellen und illegalen Reichtumsmehrung ihr Unwesen treibt. Die Eintrittskarte in den Club der Auserwählten ist ein zu begehender Mord. Jeder könnte dort Mitglied sein, auch Darks Vorgesetzte oder die Kollegen. Wem kann er in dieser Situation überhaupt noch trauen?
Aber das alles an Verwicklungen reicht unserer Autorin immer noch nicht. Auch die Verstorbenen, die man sich doch eigentlich lieber six-feet-under wünscht, dürfen in ihrem Roman als Geister und Gespenster weiterleben – wenn auch für die meisten Menschen unsichtbar – aber eben nicht für alle. Auch Jonathan Dark hatte in seiner Kindheit die Gabe, die Toten sehen zu können, hat dies aber erfolgreich verdrängt und verleugnet, bis es in Vergessenheit geraten war. Jetzt braucht er aber die Kooperation mit einigen der untoten Seelen, um den Fall aufklären zu können.
Viel Holz also, zu viel Holz – wurde da zwischen zwei Buchdeckel gepackt. Die Geschichte ist jetzt kein Totalausfall, aber große Ansprüche an Handlung und Charaktere sollte man in diesem Fall nicht haben, auch der Spannungsfaktor ist so lala – Gänsehaut kam bei mir nur auf, wenn mal ein kühles Lüftchen über die Terrasse wehte. Am Ende der fast 400 Seiten war ich dann irgendwie froh, dass es endlich vorbei war. Die Handlung wirkt seltsam uninspiriert, die Charaktere kommen meist seelenlos daher, spuken schemenhaft durch die Szenerie. Die Geschichte fesselt kaum, alles bewegt sich immer nur an der Oberfläche, und der Roman wurde wohl auch ohne große Recherche geschrieben.
Marie, die geburtsblinde Frau, ist in Wirklichkeit nicht mehr blind, denn sie wurde vor kurzem erfolgreich operiert und kann jetzt wieder sehen. Aber sie trägt weiterhin eine Augenbinde, weil sie sich ihre ganz eigene Welt und ihre Sicht auf die Dinge und Menschen erhalten will, – und dass, obwohl der Stalker hinter ihr her ist und sie ihn als Sehende leicht identifizieren könnte – so suggeriert es jedenfalls der Roman. Aber könnte sie ihren Peiniger wirklich erkennen?
Ich empfehle an solchen Stellen immer das Buch: Robert Kurson, Der Blinde, der wieder sehen lernte. Und ja, den Stalker haben sie erwischt, aber irgendwie war das dann nur noch eine kleine Fußnote wert, wie so vieles andere auch. Wer unbedingt etwas mit Toten lesen oder sehen möchte – aber unterhaltsamer – sollte sich vielleicht lieber The Six Sense mit Bruce Willies ein viertes Mal anschauen. Oder sich mal an etwas Intellektuelleres wagen, wie Geschlossene Gesellschaft oder Das Spiel ist aus von Jean-Paul Sartre. Auch er lässt in seinen Geschichten die Toten weiterleben.
Zwei
Immer noch gutes Wetter, den dritten Tag in Folge, das will in Norddeutschland etwas heißen. Immer noch Terrasse. Mein Hüftgold gedeiht gut. Beim zweiten Buch hatte ich meine Erwartungen schon im Vorhinein etwas runtergeschraubt, denn schon beim Titel Für immer beste Freunde – Der blinde Junge, der mir die Welt erklärte von Jim Bradford rollten sich mir die Fußnägel hoch – wobei der amerikanische Titel The Awakening of HK Derryberry viel passender ist und auch nicht so pathetisch daher kommt.

Und darum geht es: Ein wohl situierter amerikanischer Manager im besten Mannesalter trifft zufällig – oh nein, in gods own country geschieht nichts nur zufällig – auf einen blinden, vernachlässigten neunjährigen Jungen, der in einem Schnellrestaurant an seinem Radio lauscht und sonst beschäftigungslos und apathisch auf seine Grandma wartet, die jedes Wochenende samstags und meist auch sonntags 9 Stunden dort arbeiten muss, um über die Runden zu kommen. Neun Stunden, das ist die Zeit, die auch der Junge dort gelangweilt verbringt, denn am Wochenende ist keine Schule und für einen Babysitter hat Grandma kein Geld.
HK, so nennt man ihn, ist eine Halbwaise, seine Mutter starb noch vor seiner Geburt bei einem Autounfall – ihn, das Frühchen, konnten sie durch einen Noteingriff noch retten. Der Vater des Kindes verschwand ebenfalls schon kurz darauf aus seinem Leben. Nun sorgt die Großmutter für ihn, die selbst kaum genug zum Leben hat, denn sie gehört zu den Millionen working poors in den USA, und ist mit der Aufzucht des Frühchens eigentlich heillos überfordert.
Sie lebt mit HK in einer heruntergekommenen Gegend, in einem heruntergekommenen Haus mit Kisten als Sitzgelegenheit und einet Doppelherdplatte als einzige Kochmöglichkeit. Das andere Amerika eben. Da trifft es sich gut, dass sich Jim Bradford, so heißt der Manager und gute Christ, des Jungen an Vater statt annimmt, ihn mit in den Gottesdienst schleppt und schnell zu seinem Förderer wird. Er schließt HK in sein Herz, führt ihn in die besseren Kreise der Gesellschaft ein und erschließt ihm durch seine Beziehungen und Möglichkeiten eine ganz neue Welt. Diese schöne neue Welt zeigt sich vom Witz, dem Lebenselan, der Begeisterungsfähigkeit und der Neugierde des kleinen Mannes mit Mehrfachbehinderung angetan – HK misst aufgrund seiner extremen Frühgeburt und seiner halbseitigen Lähmung auch als Erwachsener nur 125 cm. Der gute Dünger in Form von Förderung und Aufmerksamkeit lassen den Jungen bestens gedeihen. Er schafft, nach einigen Anläufen, sogar den Highschool-Abschluss und zeigt schon früh sein beeindruckendes Talent als Entertainer.
Für immer beste Freunde ist die Geschichte von HK und seinem Förderer Jim Bradford, eine Geschichte, die Mut machen soll: Glaube an Gott, glaube an dich – und du wirst sehen, was du davon hast. Die Geschichte ist herzzerreißend, ohne Frage, Erbauungsliteratur vom Feinsten, so rührend geschrieben, dass selbst ein hartherziger, atheistischer Buchkritiker wie meine Wenigkeit an manchen Stellen Pipi in den Augen hatte. Professionell geschrieben und absolut empfehlenswert für alle, die dieses Genre lieben und sich einen unkritischen Blick auf die Welt bewahren möchten. Und das Ende der Geschichte: HK wird berühmt und Motivationsredner – God bless Amerika.
Das Wetter ist umgeschlagen, zu kalt für die Terrasse. Aber vier Tage warm, da kann man nicht meckern.
Drei
Sehbehindert – na und? Mut tut gut so lautet der Titel des Buches der stark sehbehinderten Autorin Heidemarie Feucht aus Österreich. Ihre Augenkrankheit brachte seit frühester Kindheit immer wieder Operationen und Klinikaufenthalte mit sich, ihr Sehrest wurde im Laufe der Jahre immer geringer, und sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich die alles verhüllende Dunkelheit noch etwas Zeit lässt.

Schmerzen, aufgrund ihrer empfindlichen Augen, sind ein ständiger Begleiter, und der schwindende Sehrest verlangt immer neue Anpassungsleistungen von ihr, um den Alltag selbstständig bewältigen zu können. Heidemarie Feucht versucht, aus jeder Situation das Beste für sich herauszuziehen, auch wenn ihre „Gugger“ ihr noch so übel mitspielen. Versuchen, das Beste aus dem Gegebenen zu machen, das ist ihre Botschaft an die Leser ihres Buches. Ihre Devise lautet: Nicht aufgeben, weitermachen und einfach ausprobieren, wie man den Alltag, der doch so viele Tücken für Sehbehinderte bereithält, möglichst selbstständig meistern kann. Und - immer neugierig bleiben! Denn nur dadurch lernt man neue Hilfsmittel oder Strategien kennen, die einem im Alltag weiter helfen können.
Heidemarie Feucht kämpft jeden Tag darum, ihre Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstständigkeit zu bewahren, auch wenn dies bedeuten kann, auch mal die Hilfe anderer in Anspruch nehmen zu müssen. „Ihr großer Wunsch ist, Menschen mit Sehbehinderung Trost zu spenden, Mut zu machen und Tipps zu geben, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.“, so der Klappentext. Ihr Anliegen ist ehrenwert und sie trägt es in einem nüchternen, sachlichen und schnörkellosen Stil vor. Die einfache Sprache dominiert und konzentriert sich auf das Wesentliche. Heidemarie Feucht nähert sich dem Thema Leben mit einer Sehbehinderung nicht philosophisch, sondern ganz pragmatisch und praktisch. Gut ist alles, was ihr im Leben irgendwie weiterhilft und es erleichtert. Auch wenn sie die Stationen ihres Lebens nur anreißt – der Leser bekommt eine Idee davon, wie es gewesen sein mag, in den „wilden“ 1960er und -70er Jahren in Österreich mit einer Sehbehinderung aufzuwachsen, und wie ein Mensch noch lange Zeit später darunter leiden kann, wenn er als Kind in Hospitälern wenig einfühlsamen Ärzten und Nonnen ausgeliefert ist und beim Aufwachsen wenig Unterstützung durch die Eltern erfährt.
Das Buch ist leicht zu lesen. Für Kenner der Materie bietet es allerdings wenig Neues. Wer das Thema Leben mit einer Sehbehinderung nicht gleich wissenschaftlich angehen oder es intellektuell zerlegen will und auf das literarische Etwas verzichten kann, den könnte das Mut-mach-Buch von Heidemarie Feucht durchaus ansprechen.
[*Pädagogischer Mitarbeiter im Internat]





